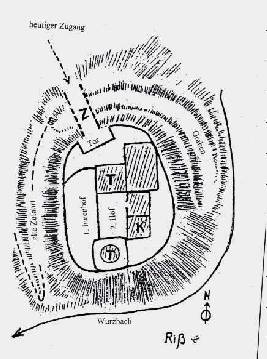Wurzstein im Steinachtal
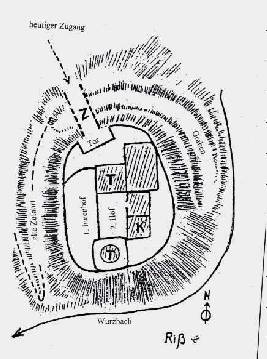
Lage:
Im Tal der Steinach zwischen
Weidenberg und Warmensteinach, Abzweigung zur Gaststätte Pfeiferhaus.
Zur Geschichte:
Auf einem Bergsporn im
Mündungswinkel von Wurzbach und Steinach östlich des Fahrwegs
von Zainhammer (Gem. Warmensteinach) zum Pfeiferhaus befindet sich
der Standort einer ehem. Burganlage, von der keine urkundlichen
Belege bekannt sind. Nach Norden und Nordosten tiefer Halsgraben,
nach Osten Steilabfall zum Wurzbach, gegen Westen Böschung
mit Randwall. Im Nordteil geringe Grundmauerreste eines viereckigen
Turmes, südlich davon Mauerreste einer fast völlig aufgefüllten
Zisterne. Schriftliche Hinweise, dass es sich hier um die Burg "Gurtstein"
gehandelt haben soll, sind falsch, diese lag in Weidenberg.
Literatur:
Hofner Hans:
Der Burgstall
Wurzstein bei Zainhammer im Steinachtal
Der Siebenstern 1957,
S. 80-83
Burgruine Wurzstein aus dem
Dornröschenschlaf erweckt
Harald Herrmann
Über Jahrhunderte hinweg war die Burgruine
Wurzstein im Steinachtal, in der Nähe des Warmensteinacher
Ortsteils Zainhammer gelegen, in einen Dornröschenschlaf gehüllt.
Büsche und Wildwuchs haben vor allem in den letzten Jahrzehnten
dazu geführt, dass selbst ältere Warmensteinacher, die
im Heimatkundeunterricht der Volksschule noch von der einstigen
Burg auf dem Wurzstein gehört hatten, den Weg dorthin nicht
mehr fanden. Schließlich war es dann auch der berühmte
Zahn der Zeit, der die Überbleibsel auf dem Felssporn zwischen
Steinach und Wurzbach auf wenige, teilweise völlig überwachsene
Mauerreste dezimierte.
Nun wurde durch einige teilweise voneinander
unabhängige Aktivitäten die Burgruine Wurzstein vor dem
völligen Vergessen bewahrt. Zum einen hat sich eine Arbeitsgruppe
aus Forschern und interessierten Laien zusammen gefunden, die Material
sowohl über die Anlage auf dem Wurzstein, als auch auf dem
Schlosshügel bei Sophienthal gesammelt und diese Erkenntnisse
in einer Arbeitstagung im Waldhotel Pfeiferhaus vorgestellt hat.
Unter dem Slogan und Logo „Das Mittelalter im Steinachtal“ hat diese
Arbeitsgruppe sowohl den Gipfel des Wurzsteins aus auch des Schlosshügels
begehbar gemacht. Für die Burgruine Wurzstein war dies hauptsächlich
der Verschönerungsverein Warmensteinach. Von einem vorhandenen
Rundwanderweg zweigt ein gut beschilderter Aufstieg zum Burghügel
ab. Träger dieses Projektes, das vom Naturpark Fichtelgebirge
unterstützt und gefördert wurde, war die Gemeinde Warmensteinach.

Schließlich hat der Hobbyhistoriker Harald
Herrmann der einstigen Burg Wurzstein ein über 200seitiges
Buch gewidmet. Eine Infotafel des Verschönerungsvereins mit
Texten teilweise aus diesem Buch am Halsgraben der Burg, umreißt
dem Wanderer in kurzen Zügen das Wesen der einstigen Verteidigungsanlage.
Aufgrund nahezu völlig fehlender schriftlicher Aufzeichnungen
über den Wurzstein, war es erforderlich, sich der Burg auf
anderen Ebenen zu nähern. Hier wurde zunächst die Burgenforschung
bemüht, die vergleichende Elemente zur Verfügung stellte.
Weiterhin boten sich Vergleiche mit ähnlichen Ruinen der Gegend,
eine Betrachtung der politischen Situation im mittelalterlichen
Steinachtal und eine Untersuchung der Topografie des geografischen
Umfeldes an. Schließlich wurden die Führung der Altstraßen
und die einstige Montanindustrie im Steinachtal in die Überlegungen
einbezogen.
Bereits die spärlichen Überreste auf
dem Burgberg lassen bei genauerer Betrachtung Rückschlüsse
auf das Aussehen der ehemaligen Verteidigungsanlage zu. Im Norden
ist der Halsgraben zu erkennen, der die Burg an der schmalsten Stelle,
dem Hals, vom restlichen Bergrücken trennte. Dem gegenüber
sind im Süden des Burghügels rechtwinklige Mauerreste
erhalten, die aufgrund ihrer Position auf dem Burgberg als der Bergfried
gedeutet werden können.
Auch wurde die Führung des
äußeren Berings und der Teilringmauer um die innere Hauptburg
bestimmt. Der Fund eines Helmes zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf
dem Wurzstein wurde herangezogen, um die Beschreibung der Ringmauer
zu ergänzen. Dazu diente besonders das Einschussloch eines
Armbrustbolzens.
Beinahe lehrbuchmäßig befindet
sich der Palas, das Wohnhaus des Ritters und seiner Familie, an
der geschütztesten Stelle der Burg, oberhalb des Steilabfalls
hin zum Wurzbach. Hier konnten sich die Bewohner der Burg im Falle
eines Angriffs sicher fühlen, denn ein Beschuss mit Pfeil und
Bogen oder einer Armbrust von dem gegenüberliegenden Hang war
im Mittelalter, also vor der Erfindung des Schießpulvers,
wenig effektiv.

Eine mittelalterliche Burg wurde nicht zum Selbstzweck
errichtet, dazu war der Bau einer derartigen Anlage zu teuer. Auf
der Suche nach den Aufgaben der Burg Wurzstein kommt natürlich
die Sicherung einer bedeutenden Altstraße aus dem Fränkischen
durch das Fichtelgebirge ins Böhmische in Frage. Weiterhin
lagen im Umfeld des Wurzsteins bedeutende Eisenbergwerke und sogar
ein Goldbergwerk soll unweit der Burg, im Schrammengraben, bestanden
haben. Außerdem gibt es Hinweise, dass die Waldwirtschaft
der Umgebung vom Wurzstein aus geregelt wurde. Eine letzte, ebenso
bedeutende Funktion der Anlage lag sicherlich in der Grenzsicherung
zwischen dem bayerischen Nordgau und dem fränkischen Radenzgau.
Hier könnte jedoch auch die Grenze zwischen dem 1007 neu gegründeten
Bistum Bamberg und dem älteren Bistum Regensburg eine Rolle
gespielt haben. Dieser Grenzsaum zog sich irgendwo an den Hängen
des Steinachtals entlang und beruhte auf einer Grenze aus dem Jahr
1061. Erst 1393 wurde diese Grenze in einer R
ainbeschreibung klar definiert. 1536 erneuerte
man die Grenzmarken teilweise mit in Stein gehauenen Nummern, versehen
mit den Wappen der Markgrafen und der Bayern.
Es sind unter
anderem die fehlenden architektonischen Merkmale, die eine Datierung
der Ruine Wurzstein erheblich erschweren. Dennoch deutet einiges
darauf hin, dass die Burg im 11. Jahrhundert errichtet wurde. Die
Neuzuordnung einer Schenkungsurkunde von 1069 durch den Historiker
Dr. Konrad-Röder erhärtet diese These. Weiterhin fügt
sich diese Jahreszahl in das Gesamtbild in Bezug auf das neue Bistum
Bamberg.
Auch über den Untergang der Burg Wurzstein existieren
keine Aufzeichnungen. Fest steht, dass sie 1692, als Magister Will
unter anderem das Steinachtal bereiste und das Fichtelgebirge als
das „Teutsche Paradeiß“ lobte, bereits zur Ruine verfallen
war. Ob sie allerdings durch Kriegseinwirkungen zerstört wurde,
oder einfach das Schicksal vieler kleinerer, mittelalterlicher Burgen
teilte, die aufgrund veränderter wirtschaftlicher und sozialer
Strukturen nicht mehr benötigt wurden, kann nicht eindeutig
ermittelt werden.
Literaturhinweis:
Harald Herrmann
Burgruine Wurzstein im
Steinachtal
Die Ruine Wurzstein ruht in einem Dornröschenschlaf
im Steinachtal in der Nähe von Warmensteinach. Nur noch einige
Bodenstrukturen sowie spärliche Mauerreste zeugen von der ehemaligen
Burganlage. Da die Ruine Wurzstein in allen gängigen Karten
eingetragen ist, fragen Einheimische und Urlaubsgäste nach
dem Ursprung und Zweck der ehemaligen Verteidigungsanlage.
Das
Anliegen des Autors ist es, durch vergleichende Untersuchungen Licht
in die bewegte Vergangenheit der Burg zu bringen. Über viele
Jahre hinweg hat sich Harald Herrmann mit Burgenkunde beschäftigt
und sich mit den Gegebenheiten auf dem Wurzstein befasst, das interessante
Ergebnis liegt nun vor.
Heinrichs-Verlag Bamberg, ISBN 978-3-89889-130-1;
208 Seiten mit vielen farbigen Illustrationen. Preis: 18,50 EUR;
Bezugsquelle: Buchhandel.
Die Namen Wurzstein und Wurzbach
bei Warmensteinach
Siegfried Pokorny
Auf einem eindrucksvollen Bergsporn zwischen
Steinach und dem Wurzbach, der zwischen dem Pfeiferhaus und Zainhammer
(Gemeinde Warmensteinach) in die Steinach mündet, liegen die
Reste der alten Burganlage Wurzstein. Lange schlummerte sie im Verborgenen.
Erst in jüngster Zeit rückte sie wieder stärker ins
Licht der Öffentlichkeit, dank des Engagements heimatgeschichtlich
interessierter Warmensteinacher und Weidenberger Bürger. In
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem
zuständigen Forstamt wurden die steilen, bisher nur schwer
begehbaren Hänge des Bergsporns entbuscht, Hinweisschilder
angebracht, ein Rundweg angelegt und eine Informationstafel aufgestellt.
Der Name des Wurzsteins taucht zum ersten Mal
in einer Urkunde aus dem Jahr 1535 auf, in der die Belehnung eines
Angehörigen der Familie von Künsberg zu Weidenberg u.
a. mit dem „Wurtzstein“ ausgesprochen wird. Genau hundert Jahre
früher aber wird bereits der Name des Wurzbaches aktenkundig.
In einer Wildbannbeschreibung aus dem Jahre 1435 wird der „Wurczpach“
als Abschnitt einer angeblichen Grenze eines kurpfälzischen
(= oberpfälzischen) Wildbanns genannt.
Der Name des Wurzbaches
Das Bestimmungswort
Wurz- ist identisch mit dem schon vor über tausend Jahren belegten
deutschen Wort wurz in der Bedeutung ‚Pflanze, Kraut, Wurzel’, wie
es heute noch etwa in den Pflanzennamen Hauswurz und Nieswurz vorkommt.
Der Wurzbach wäre demnach ein Bach, der sich durch einen reichen
Pflanzenbewuchs auszeichnet.
Mindestens heute gilt dies weniger für seinen
Unter- als für seinen farngesäumten Oberlauf. Nach einer
anerkannten Flurnamenkunde könnte Wurz auch ‚abgehauener Baumstock’
bedeuten, so dass der Wurzbach ein Bach wäre, in dessen Bereich
es viele abgehauene Baumstöcke gegeben hat, was allerdings
für das tiefeingeschnittene Wurzbachtal wohl weniger in Fragen
kommen dürfte.
Im Einmündungsbereich des Wurzbaches in
die Steinach existierte eine nur 1692 erwähnte, seitdem aber
spurlos verschwundene Siedlung gleichen Namens. Von ihr ist lediglich
bekannt, dass sie nach Weidenberg pfarrte. Das gleiche Bestimmungswort
Wurz- findet sich – mit mitteldeutschem o statt u - in dem 1250
als Vorcbach genannten thüringischen Städtchen Wurzbach,
etwa sieben Kilometer westlich Lobenstein (Saale-Orla.Kreis). Auch
sein Name leitet sich von einem gleichnamigen Bach ab, dem „Wurzbächle“,
das in Wurzbach in die Sormitz mündet. Südlich Grafenwöhr
mündet rechts in die Heidenaab der Wurzenbach (1416 Wurtzenpach).
Einen Wurzbach, erklärt als „Verkrauteter Bach, Bach mit Wurzelwerk“,
und eine abgegangene gleichnamige Siedlung (1542 wustung wurtzbach)
gibt es im Naturpark Hassberge. Das gleiche Bestimmungswort darf
in den Namen Wurzach, Ortsteil der Stadt Rott am Inn, und Bad Wurzach
(1273 Oppidum Wurzun) im Landkreis Ravensburg vermutet werden. In
abgewandelter Bedeutung findet es sich
darüber hinaus in mehreren Kärntner
Ortsnamen in Bezug auf „Bergeinsattlungen und Übergänge,
gewissermaßen für die tiefste Wurzel eines Bergkammes“
(Kranzmayer). Bekanntestes Beispiel: der Wurzenpass südlich
von Villach. Nichts mit dieser Herkunft zu tun haben jedoch weder
der ebenfalls Kärntner Ort Wurz und das sächsische Wurzen
östlich von Leipzig. Beide sind unterschiedlicher slawischen
Ursprungs. Ob aber der Warmensteinacher Wurzbach mit dem 1069 in
einer auf den alten Nordgau bezogenen Urkunde genannten Wrzaha (aus
wurz + aha ‚Wasser’) identifiziert werden kann, bleibt aus vielerlei
Gründen zweifelhaft. Mindestens wurde dieses Wrzaha in der
wissenschaftlichen Literatur bisher ausnahmslos auf den Ort Wurz,
Ortsteil der Gemeinde Püchersreuth im Landkreis Neustadt a.
d. Waldnaab, bezogen.
Slawischer Name?
In jüngster Zeit wurde
die Ableitung des Bestimmungswortes Wurz- aus dem altslawischen
*vorta, später *vrota ‚Tor, Pforte, Tür’ vorgeschlagen,
das sich in der Bedeutung ‚Tor’ z. B. im polnischen wrota, im tschechischen
vrata, im russischen woróta erhalten hat, außerdem
in zahlreichen Ortsnamen, z. B. Vrata in Kroatien, Worotowka in
Russland. Abgesehen davon, dass die Bedeutung Tor, Pforte, Tür
für einen Gewässernamen keinen rechten Sinn macht, ist
eine solche Ableitung aus einem ganz einfachen anderen Grund nicht
möglich: Bei der Übernahme altslawischer Wortelemente
ins Deutsche wurde t nicht zu z, sondern blieb als t erhalten, wie
etwa in dem fichtelgebirgischen Bach- und Ortsnamen Zoppaten aus
slawisch *Sopotna.
Der Name des Wurzsteins
Der Name des Wurzsteins
leitet sich ganz offensichtlich von dem Bachnamen ab. Sehr wahrscheinlich
lautete der Name ursprünglich Wurzbachstein. Durch Ausfall
des Mittelglieds „bach“ wurde Name dann zu Wurzstein verkürzt,
ein in der Namengebung häufig zu beobachtender Vorgang. War
der Wurzstein aber zuerst allein ein reiner Flurname wie etwa der
des gut einen Kilometer weiter westlich gelegenen Weißensteins
und bezeichnete nur das Felsmassiv? Oder aber war er von Anfang
an einer der zahlreichen Burgennamen auf –stein (Burg Stein zwischen
Bad Berneck und Gefrees, Rudolfstein, Epprechtstein, Waldstein)?
Der von dem Bachnamen abgeleitete Name spricht eher – wie der
des Waldsteins – für einen ursprünglichen Flurnamen, der
dann auf die Burg übertragen wurde. Wann diese errichtet wurde,
ist unbekannt. Nach Norbert Hübsch, Geschäftsführer
des Historischen Vereins von Oberfranken, einem ausgewiesenen Experten
in Sachen Bodendenkmäler, dürfte sie auf
Grund von archäologischen Funden im
13. Jahrhundert angelegt worden sein.
Literatur und Auskünfte:
BLEIER,
Siegfried (2001): Warmensteinach von den Anfängen zur Gegenwart.
Ein Streifzug durch die Geschichte. Horb am Neckar.
EICHLER,
Ernst/GREULE, Albrecht/JANKA, Wolfgang/SCHUH, Robert (2006): Beiträge
zur slavisch-deutschen Kontaktforschung. Band 2. Siedlungsnamen
im oberfränkischen Stadt- und Landkreis Bayreuth. Heidelberg.
ETYMOLOGISCHES WÖRTERBUCH DES DEUTSCHEN. Erarbeitet unter der
Leitung von Wolfgang Pfeifer. Berlin (dtv). 1999
KRANZMAYER,
Eberhard (1958): Ortsnamenbuch von Kärnten. II.
Teil. Alphabetisches Kärntner Siedlungsnamenbuch. Klagenfurt.
KRÖLL, Joachim (1967): Geschichte des Marktes Weidenberg.
Bayreuth.
HERRMANN, Harald (2008): Burgruine Wurzstein im Steinachtal.
Eine typologische Studie. Bamberg.
ROSENKRANZ, Heinz (1982):
Ortsnamen des Bezirks Gera. Herausgegeben vom Kulturbund der Deutschen
Demokratischen Republik - Kreissekretariat Greiz.
SCHMIEDEL, Werner (1973): Landkreise Ebern und
Hofheim. Historischer Atlas von Bayern, Unterfranken, Band 2. München.
SCHNETZ Joseph: (1997): Flurnamenkunde. 3. unveränderte
Auflage der ersten Auflage von 1951. München.
SCHWARZ,
Ernst (1960): Sprache und Siedlung in Nordostbayern. Nürnberg.
ŠMILAUER, Vladimír (1970): Prírucka slowanské
toponomastiky. Handbuch der slawischen Toponomastik. Prag.
STADTVERWALTUNG
WURZBACH
STURM, Heribert (1978): Neustadt an der Waldnaab –
Weiden. Gemeinschaftsamt Parkstein, Grafschaft Störnstein,
Pflegamt Floß (Flossenbürg). Historischer Atlas von Bayern,
Teil Altbayern, Heft 47. München.
WILL, Johann, Das Teutsche
Paradeiß in dem vortrefflichen Fichtelberg. Mit Fascimile-Wiedergabe
des Original-Titelblattes und einer von gleicher Hand stammenden
Karte des Fichtelgebirges, in: Archiv für Geschichte und Alterthumskunde
von Oberfranken 16. 1885.
WILL, Dr. J. (1939): Die
Ortsnamen des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab.
In: Heimatblätter für den oberen Naabgau, 17. Jg. S. 19-56.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Wurzach#Geschichte
Dieser Aufsatz ist mit Bildern zu finden bei
http://www.bayern-fichtelgebirge.de/heimatkunde/index.html
|