Luisenburg-Felsenlabyrinth
Betrachten
wir zunächst die Entstehung der einmaligen Felsenlandschaft
mit europäischer Einmaligkeit: Vor 240 Millionen
Jahren (im Oberkarbon) füllten sich die Hohlfalten
eines längst nicht mehr existierenden Hochgebirges
mit glühendflüssiger Schmelze. In langen Zeiträumen
erstarrte das Magma zum kristallinen Tiefengestein Granit.
Die darüber liegende Decke von Schiefern (Phyllith,
Quarzit) und Marmor wurde in der Zeit bis heute zum
größten Teil abgetragen. Seit Tertiär
(vor 30 Millionen Jahren) griff die Oberflächenverwitterung
auch in den Granit selbst ein. Dazu leisteten ihr die
im Granit durch ungleichmäßige Abkühlung
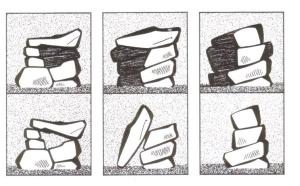 vorgebildeten
Horizontal- und Vertikalklüfte Hilfe. Das fast
tropische Klima des Tertiärs begünstigte die
chemische Verwitterung; der Frost und die rhythmischen
Temperaturschwankungen des anschließenden Diluviums
(Eis- und Zwischeneiszeit) dagegen zeigten eine heftige
mechanische Verwitterung. Da die Abtragung am ehesten
die Ecken angreift, entstanden zunächst im Gesteinsverband
wollsack- bis matratzenförmige Gebilde. Als das
Abtragungsgut im Zusammenhang mit nacheiszeitlichen
Fließerden herausgeschwemmt wurde, veränderten
die inzwischen mehr oder weniger isolierten Blöcke
ganz langsam ihre Lage; ein Vorgang, der sich auch heute
noch, wenn auch mit kaum merklicher Geschwindigkeit,
fortsetzt. vorgebildeten
Horizontal- und Vertikalklüfte Hilfe. Das fast
tropische Klima des Tertiärs begünstigte die
chemische Verwitterung; der Frost und die rhythmischen
Temperaturschwankungen des anschließenden Diluviums
(Eis- und Zwischeneiszeit) dagegen zeigten eine heftige
mechanische Verwitterung. Da die Abtragung am ehesten
die Ecken angreift, entstanden zunächst im Gesteinsverband
wollsack- bis matratzenförmige Gebilde. Als das
Abtragungsgut im Zusammenhang mit nacheiszeitlichen
Fließerden herausgeschwemmt wurde, veränderten
die inzwischen mehr oder weniger isolierten Blöcke
ganz langsam ihre Lage; ein Vorgang, der sich auch heute
noch, wenn auch mit kaum merklicher Geschwindigkeit,
fortsetzt.
Eine
Botanische
Rarität
in den Felsnischen ist das Leuchtmoos. Das Pflänzchen
hat nicht die  Fähigkeit
des Selbstleuchtens, es strahlt das Tageslicht im Zellaufbau
des Vorkeims wider. Fähigkeit
des Selbstleuchtens, es strahlt das Tageslicht im Zellaufbau
des Vorkeims wider.
Unternehmen
wir einen Rundgang durch die einmalige
Fels- und Waldkulisse der Luisenburg und nehmen uns
dazu 1 ½ Stunden Zeit. Den Labyrinth-Eingang
finden wir beim Kassenhäuschen südlich der
Freilichtbühne (Hinweisschilder). Der Aufstieg
erfolgt mit blauem Pfeil; der Abstieg mit rotem Pfeil.
Festes Schuhwerk wird empfohlen. Der gut begehbare Weg
führt durch Felsschluchten, durch niedrige Felsblöcke
hindurch und über Treppen, an Felsen mit rührseligen
Inschriften vorbei hinauf zum Gipfelkreuz (höchster
Punkt des Labyrinths, 785 m ü.NN) mit guter Rundsicht.
Beim Abstieg wieder sehenswerte Felsformationen. (Im
Labyrinthführer, den man am Kassenhäuschen
erhält, werden alle Sehenswürdigkeiten ausführlich
beschrieben).
Erschließungsgeschichte: Von 1790 an begann man
in die bis dahin gemiedene Felsenwildnis einzudringen,
sie durch Einebnen von Schluchten und Austrocknen von
Sümpfen begehbar zu  machen. Den Endpunkt dieses ersten Teils
der Erschließung des damaligen Luxburggebietes
markierte man mit der Inschrift: "Bis hierher und
nicht weiter". Nach Umbenennung der Luxburg in
Luisenburg 1805 erfolgten weitere Erschließungsmaßnahmen.
Der Hauptinitiator war der Wunsiedler Bürgermeister
und Kreisarzt Dr. Johann Georg Schmidt. Nach dem Ende
der französischen Besetzung des Bayreuther Landes
(1806-1810) führten drei seiner Söhne ab 1811
das Werk des Vaters fort. Unterstützt von Gästen
des Alexandersbades und anderen vermögenden Freunden
machten sie den Bereich der beiden ehem. Burgen und
die daran anschließenden Felspartien zugänglich.
1815 errichtete man auf dem höchsten Punkt das
erste Holzkreuz, 1819 bezog man als letztes noch die
Gegend um die sog. Dianaquelle mit in die Anlagen ein.
1820 war die Erschließung vollendet. Das Felsenlabyrinth
wurde damit zur größten Attraktion des Fichtelgebirges. machen. Den Endpunkt dieses ersten Teils
der Erschließung des damaligen Luxburggebietes
markierte man mit der Inschrift: "Bis hierher und
nicht weiter". Nach Umbenennung der Luxburg in
Luisenburg 1805 erfolgten weitere Erschließungsmaßnahmen.
Der Hauptinitiator war der Wunsiedler Bürgermeister
und Kreisarzt Dr. Johann Georg Schmidt. Nach dem Ende
der französischen Besetzung des Bayreuther Landes
(1806-1810) führten drei seiner Söhne ab 1811
das Werk des Vaters fort. Unterstützt von Gästen
des Alexandersbades und anderen vermögenden Freunden
machten sie den Bereich der beiden ehem. Burgen und
die daran anschließenden Felspartien zugänglich.
1815 errichtete man auf dem höchsten Punkt das
erste Holzkreuz, 1819 bezog man als letztes noch die
Gegend um die sog. Dianaquelle mit in die Anlagen ein.
1820 war die Erschließung vollendet. Das Felsenlabyrinth
wurde damit zur größten Attraktion des Fichtelgebirges.

|

|
Wissenschaftler
kamen jetzt zu der Überzeugung, dass die Naturlandschaft
„Luxburg“ auch der älteste Landschaftsgarten Deutschlands
ist. Wie in der Mitteldeutschen Zeitung vom 3. April
2003 zu lesen ist, hat Frau Nicola Deutrich in ihrer
Examensarbeit festgehalten, dass bereits im Jahr 1740
vom Wunsiedler Amtshauptmann von Lindenfels in einem
zuvor kaum betretbarem Felsengebiet der Luxburg Granitsteine
gesprengt wurden. Wenn die damaligen Sprengarbeiten
tatsächlich der Begehbarmachung der Felsenlandschaft
gedient haben und nicht der Granitsteingewinnung, dann
hätten wir tatsächlich auf der Luisenburg
den ältesten bürgerlichen Landschaftsgarten
Deutschlands.
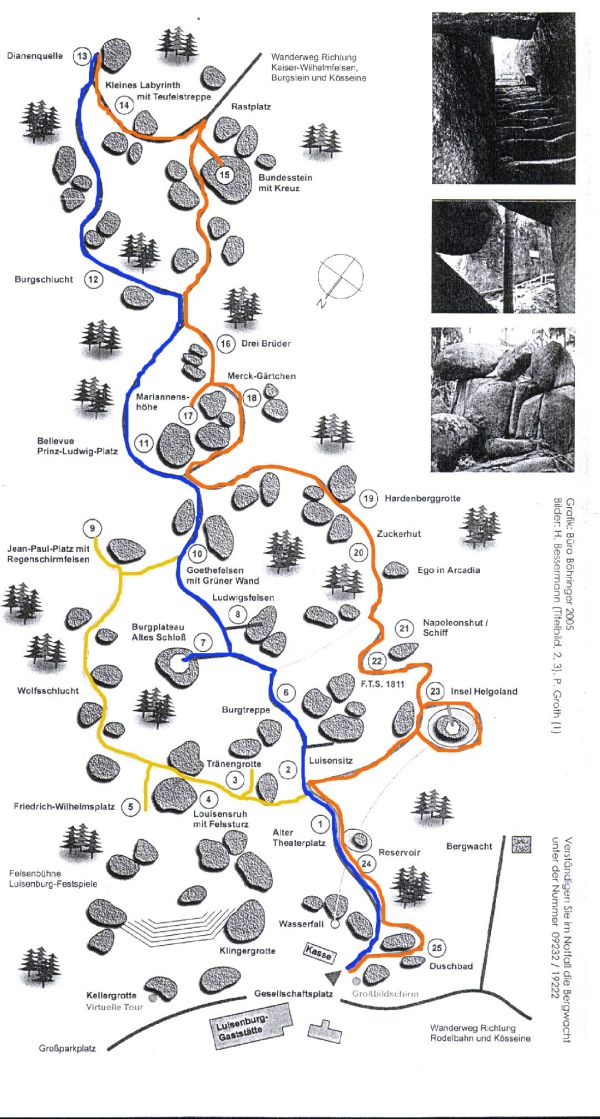
|